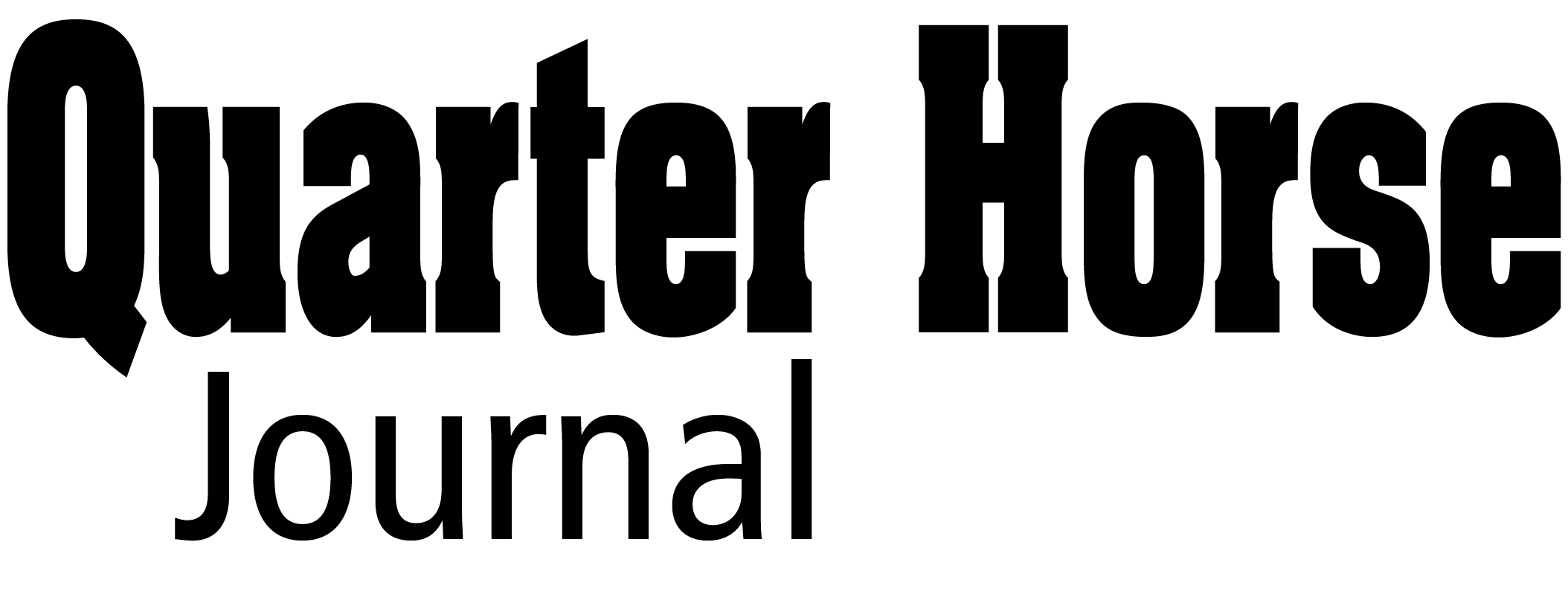Zwischen Struktur und Spüren

Pferdegerechte Trainingsroutine
Die Frage nach der richtigen Trainingsroutine beschäftigt viele Pferdemenschen – unabhängig von Disziplin, Ausbildungsstand oder Zielsetzung. Wie oft sollte trainiert werden? Was gehört in eine ausgewogene Woche? Und wie lässt sich Fortschritt erzielen, ohne das Pferd zu überfordern?
Eine sinnvolle Antwort liegt nicht allein im Trainingsplan, sondern in der Einstellung dahinter, denn eine gute Routine beginnt nicht bei der Methode, sondern beim Blick aufs Pferd. Sie lässt sich nicht verallgemeinern, folgt aber bestimmten Prinzipien: Achtsamkeit, Anpassungsfähigkeit und eine klare, aber flexible Struktur. Dieser Artikel beleuchtet, wie ein solcher Rhythmus aussehen kann: nicht als starres System, sondern als lebendige Grundlage für nachhaltiges Lernen und gesunde Entwicklung beim Partner Pferd.
Zuhören statt durchplanen
Pferdegerechtes Training beginnt nicht mit einem Ziel, sondern mit Wahrnehmung. Der Zustand des Pferdes – körperlich wie emotional – sollte die Richtung vorgeben, nicht ein vorab formulierter Plan. Wer ausschließlich nach Vorgabe arbeitet, läuft Gefahr, Signale des Pferdes zu übersehen oder zu übergehen.
Eine Trainingsroutine darf Orientierung bieten, ohne rigide zu sein. Sie entsteht im Dialog – nicht im Durchsetzen. Der Einstieg in jede Einheit sollte der Beobachtung und Verbindung dienen: Wie wirkt das Pferd heute? Ist es wach, angespannt, offen, abwartend? Erst aus diesen Eindrücken heraus kann sinnvoll entschieden werden, was der Tag an Arbeit oder eben auch an Pause mit sich bringt.
Eine Woche mit Struktur und Spielraum
Trotz aller Offenheit ist ein grober Rahmen hilfreich, um das Training sinnvoll zu organisieren. Ein ausgewogener Wochenplan schafft Abwechslung, fördert die ganzheitliche Entwicklung des Pferdes und verhindert einseitige Belastungen. Ein möglicher rhythmischer Aufbau könnte wie folgt aussehen:
1 bis 2 Tage Bodenarbeit
Förderung der Kommunikation, Verfeinerung der Körpersprache, Schulung von Aufmerksamkeit und Führung
→ Tipp
Bodenarbeit ist auch im Westerntraining keine „Vorstufe“, sondern ein essenzielles Werkzeug. Führtraining mit minimalen Signalen, Rückwärtsrichten ohne Zug am Strick, präzise Wendungen auf Körpersprache – all das verbessert auch das Reiten.
Insbesondere für Jungpferde oder nervöse Pferde im Turnierumfeld ist gezielte Bodenarbeit ein idealer Anker.
1 bis 2 Tage gymnastizierende Arbeit unter dem Sattel
Entwicklung von Balance, Losgelassenheit, Beweglichkeit und Koordination – immer mit klaren Pausen und positiver Verstärkung.
→Tipp
Diese Einheiten sind die Grundlage für Elemente wie Stops, Spins oder Lead Changes. Statt an der Lektion selbst zu arbeiten, lohnt es sich, an Vorbereitung und Balance zu feilen: Zirkel in verschiedenen Größen, Übergänge nur über Sitz, Schenkelweichen zur Lockerung – alles in feinem Tempo.
Achte auf Rückmeldung vom Pferd: Ist es durchlässig oder „macht es nur mit“?
1 Tag Gelände oder Spaziergang
Entspannung, Abwechslung, Umweltreize und mentale Auslastung – essenziell für ein stabiles Nervensystem.
→ Tipp
Nutze das Gelände bewusst zum „Übersetzen“ von Trainingsinhalten.
Ein ruhiges Rückwärtsrichten an der Wiese, Seitengänge auf einem Feldweg, ein ruhiger Galopp auf weichem Boden – das alles bringt Gelassenheit in den Alltag. Und: Viele Showpferde profitieren enorm davon, mal nicht auf Bodenmarkierungen achten zu müssen.
1 bis 2 Tage Pause oder freie Bewegung
Regeneration als fester Bestandteil des Trainings. Ob auf der Koppel, im Paddock oder durch freie Bewegungszeit, denn echte Entwicklung braucht Erholungsphasen.
→ Tipp
Pausen sind besonders wichtig bei Pferden, die viel auf Timing und Tempo trainiert werden.
Nutze freie Tage, um das Pferd ohne Erwartungen zu erleben. Auch ein gemeinsames „Dabeisein“ – z. B. einfach mit dem Pferd auf dem Platz stehen – stärkt die Verbindung.
Manche der besten Trainingsimpulse entstehen eben genau nicht im Training.
Zielangepasste Struktur
Diese Wochenstruktur ist ein Beispiel, kein starres Muster. Sie verändert sich je nach Zielsetzung:
• In der Turniervorbereitung wird z. B. gezielter auf Abläufe und Präzision hingearbeitet, aber mit regelmäßigen „Reset“-Tagen dazwischen.
• In der Jungpferdeausbildung liegt der Fokus auf kurzen Einheiten, viel Bodenarbeit, Umweltgewöhnung und ruhigem Aufbau.
• In der Rehabilitation ist medizinische Rücksprache zentral, oft geht es zunächst nur um Mobilisation, Atmung und Vertrauen.
Die Aufteilung ist nicht als starre Vorlage zu verstehen, sondern als Beispiel. In der Praxis wird die Struktur immer vom Ziel des Trainings beeinflusst:
Ein Pferd in der Turniervorbereitung braucht einen gezielteren Aufbau mit präzise gesetzten Belastungsreizen, mentaler Stabilisierung und konditionellem Feintuning.
Ein Jungpferd hingegen benötigt deutlich kürzere, spielerische und sehr dosierte Einheiten mit vielen Pausen und einem Fokus auf Beziehung, Sicherheit und Umweltgewöhnung.
Ein Pferd in der Rehabilitation erfordert wiederum eine medizinisch abgestimmte Struktur mit vorsichtiger Steigerung und viel Ruhephasen dazwischen.
Zielorientiertes Training bedeutet also nicht, das Pferd in ein Raster zu pressen, sondern einen Rahmen zu gestalten, der seinem momentanen Bedarf dient – körperlich wie geistig.
Weniger ist oft mehr
Viele Missverständnisse im Training entstehen nicht durch mangelndes Wissen, sondern durch Überforderung – sowohl mental als auch körperlich. Pferde lernen nicht besser durch längere oder häufigere Einheiten, sondern durch…
Hier den kompletten Artikel weiterlesen…
Text: Tommy Freundlich, Foto: Michelle Leber Photography